Monokristalline Solarmodule gelten generell als bessere Wahl gegenüber polykristallinen PV-Modulen. Je nach Ihren Anforderungen können aber auch Dünnschicht-Solarpanels ideal sein. Welche Solarmodule die besten für Ihre geplante Photovoltaikanlage sind, hängt von vielen Faktoren ab.
Faktoren für die Auswahl und Kauf von Solarmodulen
Die für Ihre PV-Anlage besten Solarpanels erfüllen folgende Voraussetzungen:
- hohe Leistung
- hohe Effizienz
- hoher Wirkungsgrad
- schnelle Amortisation (= Investition rentiert sich)
- optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Langlebigkeit
- Zuverlässigkeit
- hohe Qualität
- attraktives Design
- lange Garantiezeit
Es ist kaum realistisch, dass ein Solarmodul alle Anforderungen erfüllt. Um eine schnelle Amortisation zu erreichen, sollte der Anschaffungspreis für die Solarpanels möglichst gering und ihr Wirkungsgrad ausgesprochen hoch sein. Diese Ansprüche kollidieren gegebenenfalls miteinander sowie mit der Langlebigkeit oder der Qualität. Vor allem sollten die von Ihnen gewählten PV-Module den Voraussetzungen Ihres Daches entsprechen, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Der Markt bietet Solarpanels für fast alle gängigen Anforderungen. Sie finden Modelle mit einem hervorragenden Schwachlichtverhalten, die nicht auf eine perfekte Südausrichtung angewiesen sind. Andere Photovoltaikmodule reagieren optimal auf Verschattungen. Auch für extreme Dachneigungen gibt es inzwischen Lösungen. Je geringer die verfügbare Dachfläche für die Anbringung von Solarmodulen ist, desto leistungsfähiger und wirksamer sollten die Solarzellen sein.
Wirkungsgrad, Leistung und Effizienz von Solarpanels
Bei der Anschaffung einer PV-Anlage kommt es vornehmlich auf die Leistung und damit den Wirkungsgrad an. Leistung und Wirkungsgrad bestimmen die Effizienz. Unter Berücksichtigung der Investitionskosten ergibt sich daraus die Amortisationszeit.
Die Leistung entsteht durch die Grösse der Module sowie die Art, Grösse und Anzahl der einzelnen Solarzellen. Die Hersteller geben die Nennleistung ihrer Module in der Einheit Wp (Watt peak) oder kWp (Kilowatt peak) an. Dabei handelt es sich um die Höchstleistung an Strom, die ein Modul unter optimalen Bedingungen erzeugen kann. Je grösser die Leistung, umso höher ist auch der Wirkungsgrad. Die aktuell leistungsstärksten Solarmodule erreichen Leistungen über 400 Watt peak.
Der Wirkungsgrad wiederum hängt davon ab, wie viel Energie eine Solarzelle in Strom verwandeln kann. Er ist daher bei polykristallinen und Dünnschichtmodulen trotz vergleichbarer Leistung geringer als bei monokristallinen Solarpanels. Ihren optimalen Wirkungsgrad können Solarmodule jedoch nur erreichen, wenn sie richtig verschaltet und mit einem entsprechend leistungsstarken Wechselrichter verbunden sind. Der Solarzellen-Wirkungsgrad der neuesten Generation bewegt sich zwischen 20 und knapp 23 Prozent.
Arten von Solarmodulen im Vergleich
Neben monokristallinen, polykristallinen und Dünnschichtmodulen stehen Ihnen die einzelnen Arten noch mit unterschiedlichen Aufbauten zur Verfügung, etwa als Glas-Folie- oder Glas-Glas-Module.
Monokristalline Solarmodule

Grundsätzlich gelten monokristalline Solarmodule als die Variante mit der besseren Leistung bezogen auf die Fläche. Die Ursache dafür ist die Herstellung aus einem einzelnen gezüchteten Kristall. Dazu entstehen zunächst Stäbe aus Silizium (“Ingots”), die anschliessend in Scheiben (“Wafer”) geschnitten werden.
Die monokristallinen Solarmodule erkennen Sie an ihrer einheitlichen dunkelblauen oder schwarzen Farbe. Diese Arten von Solarpanels sind die optimale Lösung, wenn Ihr Dach nur geringe Freiflächen für die Installation der Module bietet. Als Hauseigentümer mit grossen Dachflächen profitieren Sie umso mehr von dem hohen Wirkungsgrad. Diesen bezahlen Sie allerdings mit einem höheren Anschaffungspreis aufgrund höherer Herstellungskosten. Der Wirkungsgrad ist über 20 Prozent.
Polykristalline Solarmodule
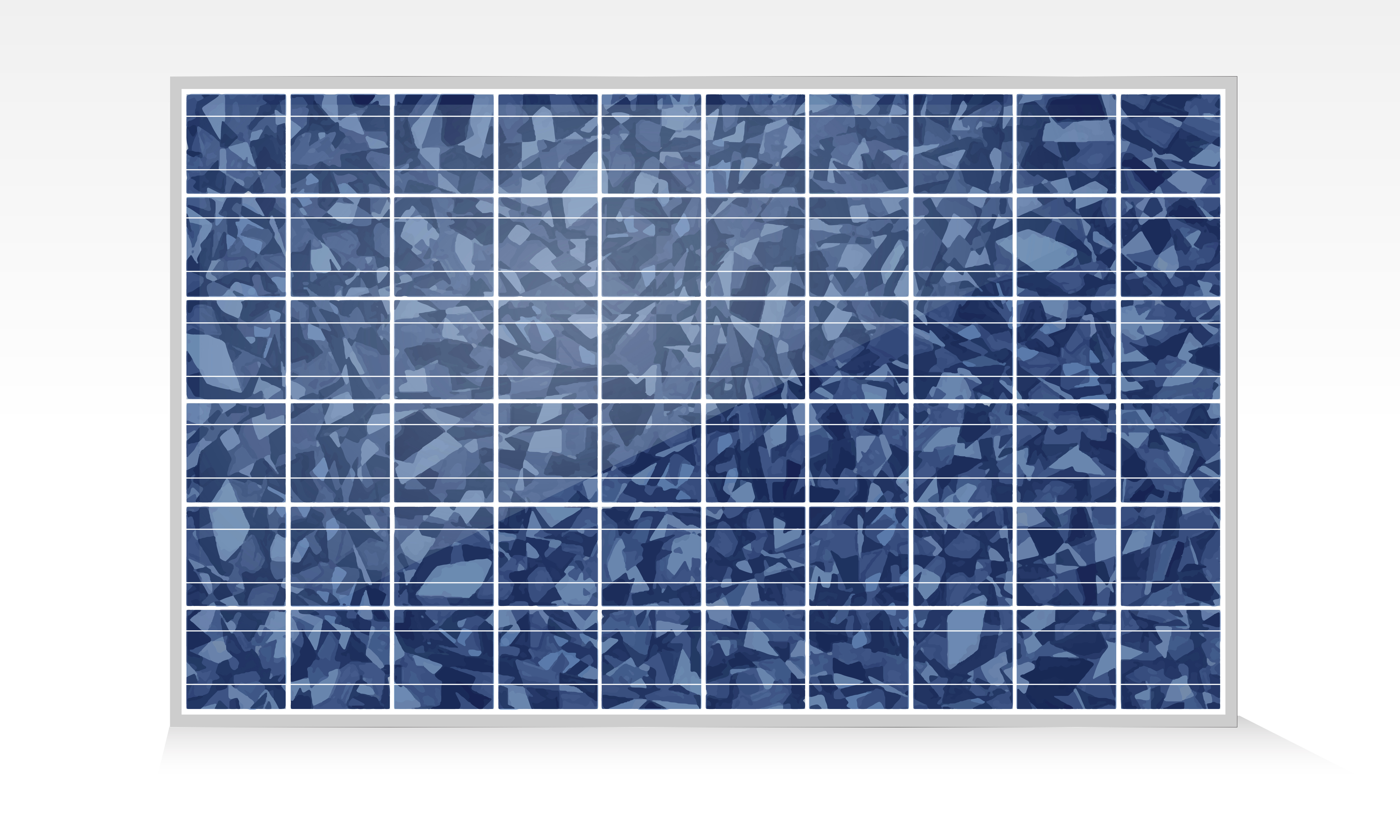
Die preisgünstigeren Modelle sind polykristalline Solarmodule. Sie bestehen nicht aus einem Einzelkristall, sondern aus aufgeschmolzenen und in der gewünschten Form abgekühlten Silizium-Teilen. Der daraus entstehende Block enthält eine Vielzahl kleinerer Kristalle. Die Blöcke werden ebenso wie monokristalline Stäbe in Wafer geschnitten.
Durch das Herstellungsverfahren erhalten polykristalline Solarzellen ein sehr unruhiges Erscheinungsbild. Da sie leichter und schneller herzustellen sind, ist ihr Preis deutlich niedriger als der von monokristallinen Solarmodulen. Damit geht jedoch auch ein um drei bis fünf Prozent geringerer Wirkungsgrad einher. Aufgrund ihrer günstigeren Preise sind polykristalline Solarpanels beliebt für die Installation auf grossen Dachflächen.
Glas-Folie- und Glas-Glas-PV-Module
Aus poly- und monokristallinen Solarzellen entstehen die sogenannten Dickschicht-Module. Die einzelnen Wafer werden auf einem Untergrund in einem Aluminiumrahmen mit einer darüber befindlichen Glasscheibe zusammengefügt. Der Untergrund kann aus einer speziellen Folie oder ebenfalls aus einer Glasscheibe bestehen. Glas-Folie-Solarmodule weisen ein geringeres Gewicht auf, Glas-Glas-Module sind dafür langlebiger und unempfindlicher gegen Beschädigungen auf der Unterseite.
Dünnschicht Solarmodule
Den Dickschicht-Modulen stehen Dünnschicht-Solarmodule gegenüber. Ihre Herstellung erfolgt aus amorphem Silizium. Diese Form unterscheidet sich aufgrund der Ausrichtung seiner Atome deutlich von kristallinem Silizium, besteht aber aus denselben Atomen und erfüllt durch Zufügung von Wasserstoffatomen dieselben Aufgaben.
Das amorphe Silizium wird in dünnen Schichten auf ein Trägermedium aufgesprüht oder aufgedampft. Als Trägermedium eignen sich Glas und tragfeste Kunststofffolien. Dünnschicht-Solarmodule sind preisgünstiger als die kristallinen Modelle. Ihr Wirkungsgrad ist jedoch deutlich geringer. Sie eignen sich aufgrund der niedrigeren Investitionskosten insbesondere für grossflächige Solarparks sowie dank ihres geringen Gewichts für Dächer mit geringer Traglast, etwa von Fabrikgebäuden oder Lagerhallen. Durch die Möglichkeit, flexible Untergründe zu verwenden, sind sie zudem ideal für alternative Dachformen.
Solarzellen aus organischen Halbleitern
Organische Halbleiter aus Kohlenwasserstoff-Verbindungen lassen sich leicht und kostengünstig herstellen. Sie könnten die Zukunft der Solarmodule darstellen. Im Vergleich zu poly- oder monokristalline Solarzellen nutzen sie keine Silizium-Halbleiter. Stattdessen erzeugen sie Strom aus organischen Molekülen, die Kohlenstoff enthalten.
Derzeit ist ihr Wirkungsgrad jedoch noch sehr gering, sodass die Entwicklung wahrscheinlich noch einige Zeit dauern wird.
Lösungen zur Optimierung von Leistung und Wirkungsgrad
Die von den Herstellern angegebenen Leistungen und Wirkungsgrade sind von optimalen Bedingungen abhängig. Eine ungünstige Verschaltung oder ein unpassender Wechselrichter können den Stromertrag reduzieren. Sie sollten daher auf eine optimale Konfiguration der gesamten Solaranlage achten.
PV-Module aller Bauweisen können zudem weitere Unterschiede aufweisen. Einige Modelle erzielen aufgrund des Auftrags der Solarzellen einen höheren Wirkungsgrad, etwa mit Halbzellen oder Solarzellen in Schindeltechnik. Andere verwenden integrierte Mikro-Wechselrichter, sodass jedes Modul unabhängig von Verschattungen seine optimale Leistung erzeugt. Die Art der Rückseite kann einen höheren Stromertrag ermöglichen, etwa bei bifazialen Modulen sowie mit PERC- oder Heterojunction-Technologie.
Auch die Anbringung der Anschlüsse auf der Rückseite (Back-Contact- oder Metal-Wrap-Trouth Technologie) begünstigen einen höheren Wirkungsgrad. Es lohnt sich also auch, bei der Auswahl die Details aller Elemente einer Photovoltaikanlage zu beachten.








.svg)
.svg)









